„Ein gutes Portrait zeigt nicht nur, wie jemand aussieht. Es zeigt, wer da ist.“
Das habe ich 2017 in einem Blogbeitrag geschrieben. Das Thema dieses Beitrages war: Selfie versus fine art Portrait
Acht Jahre später denke ich noch immer so. Aber mein Blick hat sich erweitert. Ich sehe heute drei Ebenen, die eng miteinander verwoben sind:
Das Selbstbild, das fine art Portrait und das Selfie.
Hier sind Fotografie, Psychologie, Kunstgeschichte und digitale Kultur – miteinander verwoben, hochaktuell und vielschichtig.
Doch ich möchte mit dem Selbstbild beginnen.
Das Selbstbild ist unsere mentale Vorstellung von uns selbst. Es ist ein Konstrukt – flüchtig, wandelbar, geprägt durch Erinnerungen, Zuschreibungen, Erfahrungen, Spiegelungen im Außen. Es besteht nicht aus Bildern, sondern aus Empfindungen, Gedanken und Überzeugungen. Es entsteht aus:
- Erinnerungen (wie jemand einmal über uns sprach)
- Urteilen (zum Beispiel: „Ich bin nicht fotogen“)
- Erfahrungen (wie man uns als Kind gesehen hat)
- Rollen (Mutter, Künstlerin, Außenseiterin, Kämpferin)
- Emotionen (Scham, Stolz, Unsicherheit, Stärke)
Dieses Selbstbild ist selten stabil und verändert sich im Laufe unseres Lebens, manchmal sogar mehrmals am Tag.
Je tiefer ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr bestätigt sich das, was ich intuitiv durch das aktuelle Foto von mir erlebt habe: Ein Porträt, das jemand anderes von uns macht, kann unser Selbstbild neu rahmen. Es kann berühren, irritieren, aufbrechen – und sogar festgefahrene Selbstwahrnehmungen in Bewegung bringen. Besonders dann, wenn es Aspekte sichtbar macht, die wir selbst vielleicht nie so gesehen haben. In diesem Zusammenhang drängt sich mir eine Frage auf:
Warum hat das Selbstbild von Frauen oft so wenig mit der äußeren Wahrnehmung zu tun?
Viele Frauen entwickeln ihr Selbstbild nicht aus dem Inneren heraus, sondern im Widerhall der Reaktionen anderer. Nicht das Sein wird gespiegelt, sondern das Wirken. Schon früh lernen kleine Mädchen nicht, sich selbst zu begegnen – sondern sich selbst zu beurteilen. Und wenn das Bild, das von außen zurückkommt, immer auf die Oberfläche abzielt – dann bleibt das innere Bild unscharf. Die Kultur lehrt Frauen sehr früh: Du bist, wie du aussiehst. Und: Da ist immer jemand, der schöner, schlanker, begehrenswerter ist. Das Selbstbild ist dann kein inneres Zuhause – sondern ein ständiger Abgleich mit einem Ideal, das nicht existiert.
- Wenn eine Frau erniedrigt wurde – verbal, körperlich, seelisch – dann legt sich diese Erfahrung oft auf ihr Bild von sich selbst. Nicht als Geschichte, sondern als Gefühl: – Ich bin nicht genug. – Ich bin nicht schön. – Ich bin falsch. – Ich darf nicht sichtbar sein.
Diese Sätze werden nicht laut ausgesprochen – aber sie wirken im Hintergrund.
Auch ich habe ein Selbstbild von mir, das sich – nun, mit 75 Jahren – nicht mehr um mein Äußeres dreht, sondern um Wert, Selbstbewusstsein, Klarheit, Wahrhaftigkeit. Ich habe erkannt: Mein Selbstbild hat wahrscheinlich wenig mit der Realität zu tun. Wenig mit dem, was andere sehen. Das Schreiben an meiner Autobiografie hat viele Erinnerungen hochgeholt. Der Blick auf mein Leben hat mich auch stolz gemacht auf das, was ich geleistet habe. Doch da ist immer dieser Zweifel geblieben: Reicht das? Bin ich gut genug? Darf ich meine Stimme erheben?
Und dann war ich Dienstleisterin/Portraitfotografin. Ich habe viele Frauen porträtiert. Sie kamen zu mir, weil sie ein Bild brauchten – für den Beruf, für die Familie, für sich selbst.



Während des Shootings war da noch etwas mit im Raum: eine feine Zurückhaltung, eine Skepsis im Blick, ein Moment des Sich-Sortierens. Nicht unbedingt Unsicherheit. Eher ein inneres Abtasten: Was wird sichtbar werden? Und darf ich das zulassen?



Ich habe gespürt, wie viel Angst eine Fotosession machen kann, weil etwas sichtbar werden könnte, das das Foto vielleicht etwas zeigen würde: einen Teil von ihnen, den sie selbst kaum kannten. Eine Verletzlichkeit. Oder eine Wahrheit. Ich habe gelernt, mit diesem Moment zu arbeiten – mit Stille, mit Respekt, mit Geduld.
Manchmal war das eigentliche Geschenk nicht das Foto. Sondern der Moment, in dem eine Frau sich traute, da zu sein, der Augenblick, in dem die Frau mir vertraute und sich selbst nicht mehr korrigieren wollte. Sich einfach zeigte – ohne Erklärung, ohne Absicherung.



So habe ich verstanden: Porträtfotografie ist nicht nur Handwerk. Sie ist auch Haltung. Ein Dienst – ja. Aber vor allem eine Einladung: Du darfst dich zeigen.
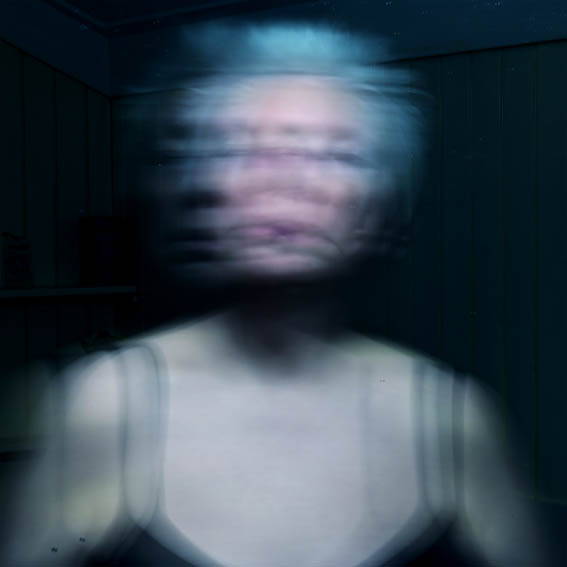

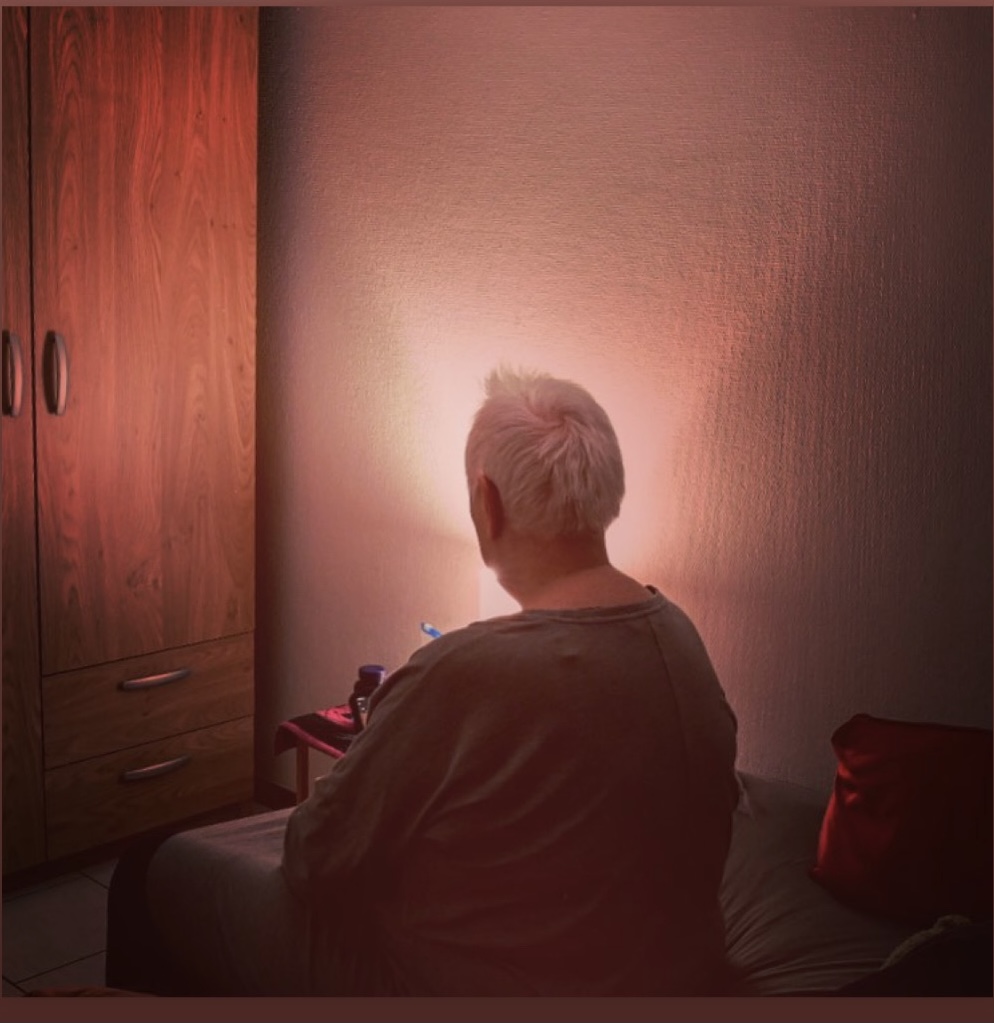
Das Selbstportrait ist in der Regel sorgfältig konzipiert, technisch durchdacht und auf innere Wahrheit ausgerichtet. Es nährt sich aus Reflexion, künstlerischer Intention und oft einem persönlichen Prozess der Selbsterkenntnis. Ein Selbstportrait liefert einen Hinweis über die abgebildete Person, die nicht nur zeigen will, wie sie aussieht und eröffnet eine neue Ebene der Selbstwahrnehmung, da es eine Suche nach Bedeutung, nicht nach Bestätigung ist. Ein Selbst-Portrait fragt: Wer bin ich.



Und dann:
400 Millionen Selfies werden pro Tag gemacht und ins Netz gestellt.
Ein Selfie ist schnell. Es ist verfügbar. Es braucht keine Erlaubnis. Es ist da – sofort. Es zeigt, was ich zeigen will – und blendet aus, was ich lieber verberge. Ein Selfie entsteht oft aus der Bewegung heraus, mit einem Lächeln, einer Pose, einem Filter. Es ist ein Spiel mit dem Bild, mit der Identität, mit der Sichtbarkeit. Es ist Ausdruck und Kontrolle zugleich. Aber ein Selfie fragt selten: Wer bist du wirklich? Es fragt: Wie wirkst du? Wie gefällst du?
Zwischen einem Selfie, einem Selbstportrait und einem Porträt, das ein anderer von mir macht, besteht ein wirklicher Unterschied, der mir heute deutlicher ist denn je.
Was bleibt
Vielleicht ist genau das die Kraft der Fotografie: Dass sie zwischen Oberfläche und Tiefe vermitteln kann.
Zwischen dem Bild, das wir zeigen – und dem, das in uns wartet, gesehen zu werden.
Ein Selfie mag sagen: Ich bin hier.
Ein Porträt kann sagen: Ich bin da.
Und manchmal, ganz selten, gelingt ein Bild, das nicht nur zeigt, wie jemand aussieht – sondern wer da ist.

